
Diese Seite ist dem Universalisten, Stoiker und Freund gewidmet, der es wie kein Zweiter versteht, Wahrheiten zu erfassen und zu ertragen, klug und optimistisch auszuleuchten und vom Affekt zu entlasten. Klaus Heitmann, meinem Vorbild und intellektuellen Bewährungshelfer dessen abenteuerlich disparate Interessen kaum je durch alltägliche Erfordernisse unterbrochen werden [being nurture far from his nature, the food intake thing will be done on the brink of collapse within minutes]
Eine Pizza für die Wahrheit
Eine Frage, die sich viele Menschen stellen und die sich die Menschen wahrscheinlich schon immer gestellt haben, lautet, ob die Welt so kompliziert ist, dass man Juristen braucht oder weil es Juristen gibt. Über diese Frage, zu der jeder ein paar treffende Beispiele beisteuern kann, lässt sich bekanntlich endlos streiten. Der Jurist freilich, dem man nachsagt, er könne sich über alles und jedes endlos streiten, was gerne als Grund dafür herangezogen wird, dass die Dinge so kompliziert seien, der Jurist wird sich an einer solchen Diskussion nicht beteiligen. Juristen sprechen nicht über Fragen, sondern über Fälle. Dagegen spricht nicht, dass Juristen schnell mit einer Theorie bei der Hand sind. Juristen geben Theorien nämlich auch schnell wieder auf, und zwar dann, wenn diese nichts dazu beitragen, einen Fall zu lösen.
Die Reihenfolge des Denkens, wonach man eine Theorie zur Lösung eines Falles bildet, lässt sich auch herumdrehen. Man kann sich auch einen Fall zu einer Theorie denken, um diese zu überprüfen. Zu den Theorien über die Kompliziertheit der Welt, die eingangs genannt wurden, denke man sich daher den folgenden Fall:
Zwei Freunde sitzen in einem Lokal und sprechen darüber, was sie im nächsten Urlaub machen. Der eine sagt, dass er im Sommer zum Surfen nach Südfrankreich gehe und zwar an den „Golf von Lyon“. Der andere ist verwundert. „Gibt es denn einen Golf von Lyon?“ fragt er, worauf er vom Surfer die Antwort erhält, er sei sich ganz sicher, denn er habe den Urlaub eben erst gebucht. Lyon, so gibt nun der andere zu bedenken, sei weder eine Hafenstadt noch habe sie irgend etwas mit dem Meer zu tun. Sie liege hunderte von Kilometern davon entfernt. Es sei nicht üblich, einen Meerbusen nach einer Stadt zu benennen, die keine Beziehung dazu habe. Immerhin, wendet der Surfer ein, sei die Stadt durch die Rhône mit dem Meer verbunden. Die Diskussion weitet sich aus. Tischnachbarn beteiligen sich. Jeder kennt einen Golf oder eine Wasserstraße, deren Namen von einer Landschaft oder einer Stadt abgeleitet sind, welche sich in unmittelbarer Nähe befindet. Schließlich ist sich der Zweifler sicher, dass sein Freund irrt. Wahrscheinlich, so denkt er, hat er Lyon mit Toulon verwechselt. So bietet er ihm eine Wette um eine Pizza darüber an, dass es keinen Golf von Lyon gebe. Der Freund schlägt ein, man geht zum Auto und holt sich einen Straßenatlas. Darin findet man im Umkreis der Rhônemündung einen „Golf du Lion“.
Was jetzt einsetzt, ist eine – endlose – juristische Diskussion. Denn die Frage lautet: „Wer hat Recht?“ Die einen argumentieren, dass man nur von einem Golf von Ly(i)on gesprochen habe. Auf eine bestimmte Schreibweise habe man sich nicht geeinigt. Der Klang der beiden Worte sei nun aber einmal gleich. Daher habe der Surfer gewonnen. Die anderen meinen, es sei allen klar gewesen, dass man über die Frage diskutiert habe, ob der Golf seinen Namen von der Stadt Lyon habe. Dagegen wendet der Surfer ein, dass er nur gesagt habe, er gehe zum Surfen an den Golf von „Ly(i)on“. Bei der Frage, ob es einen Golf solchen Namens gebe, sei ohne Bedeutung, woher der Name stamme.
Im weiteren Verlauf kommt, wie so häufig in einer juristischen Diskussion, ein Sachverständiger zu Wort. Ein Französisch-Kenner wirft ein, dass Golf du Lion nicht Golf von Lion, sondern Golf des Lion, nämlich des Löwen bedeute. Ein Golf mit einem Namen, wie ihn der Surfer genannt habe, gebe es also nicht. Die Gegenseite verweist darauf, dass im Vordergrund der Diskussion nur das Wort Ly(i)on gestanden habe, nicht aber eventuelle Beiwörter. Man könne nicht bestreiten, dass es einen Golf gebe, in dessen Name das Wort „Ly(i)on“ vorkomme.
In diesen verwirrenden Argumenten, die ihren Grund, wie man leicht sieht, in der Schwierigkeit der Dinge und nicht in den Theorien haben, die darüber gemacht werden, ist der Laie schnell verheddert. Daher ruft er nach dem Juristen. Dieser versucht die Argumente zu gewichten. Seine Frage lautet: „Worauf kommt es an?“ Im unserem Beispiel, in dem diese Frage kaum eindeutig zu beantworten ist, wird er, um den Fall zu lösen, allerdings am besten auf eine Theorie verzichten. Er wird den Kontrahenten einen Vergleich vorschlagen, etwa dahingehend, gemeinsam eine Pizza zu essen. Schwierig werden die Dinge allerdings, wenn die Streitenden, wie so häufig in der Welt, den Vergleich ablehnen. Dann muss sich der Jurist die Gedanken machen, von denen die Menschen später behaupten werden, dass sie die Welt kompliziert gemacht hätten
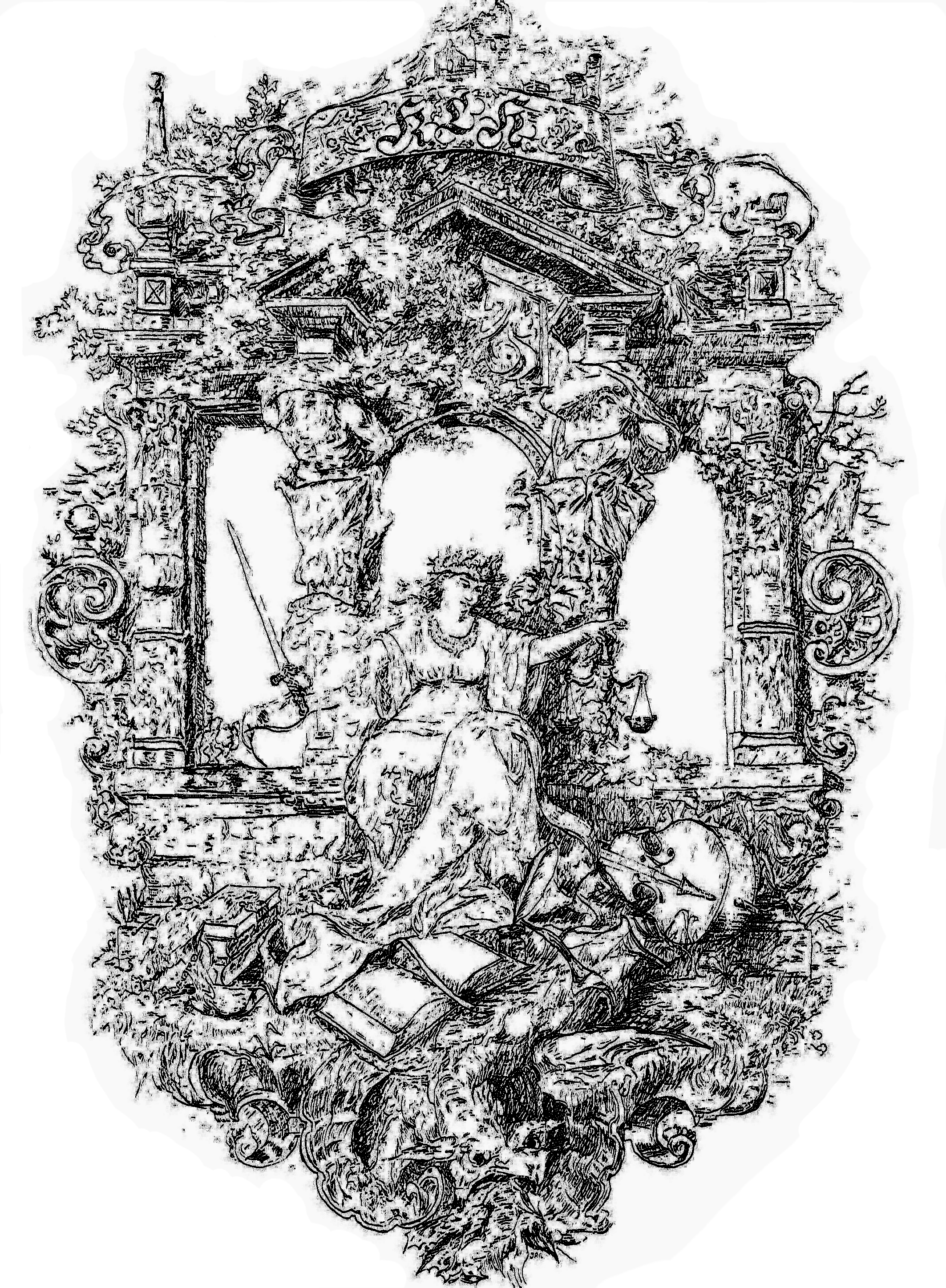
ein – und ausfälle
11.2.1996
Es ist ein Merkwürdiges mit den Religionen: Man kann sie nicht ernst nehmen. Nicht ernst nehmen kann man sie aber auch nicht.
7.4.1996
Theologen sind erstaunliche Menschen: sie gelten als besonders seriös, obwohl sie sich mit Dingen beschäftigen, die aller Vernunft widersprechen. Allerdings ist dies nur auf den ersten Blick erstaunlich. Genaugenommen zeigt sich im Falle der Theologen nur eine besonders zugespitzte Variante eines sozialen Mechanismus‘, der sich überall wiederfindet: Das Erzeugen einer Aura durch Übertreibung oder Fiktion, um soziale Wirkung zu erzielen.
10.6.1996
Künstler haben etwas von Gauklern. Man weiß bei ihnen nie so recht, was ernst gemeint ist und was nicht. Die Wirklichkeit und ihre Vorspiegelung sind bei ihnen mehr als ohnehin schon miteinander verwoben, Schein und Durchscheinen besonders schwer zu trennen. Mit anderen Worten: Künstler sind Spezialisten für die Doppelbödigkeit. Dies ist ein Problem für die, welche bei ihnen die Wahrheit suchen, für die Menschen also, welche die Dinge hauptsächlich ernst nehmen, das heißt für solche, die wenig künstlerisch veranlagt sind. Sie kommen sich notwendigerweise um so mehr verschaukelt vor, je offensichtlicher das Gauklertum des Künstlers in den Vordergrund tritt – was allerdings nicht bedeutet, dass sie dort, wo sie sich ernst genommen fühlen, der Wahrheit näher wären.
9.6.1996
Die Theologiewissenschaftler sind in einer besonderen Schwierigkeit. Wenn sie, wie in den exakten Wissenschaften, über ihren Gegenstand Hypothesen aufstellen, mit der Aufforderung an andere Wissenschaftler, diese zu falsifizieren, kommen sie mit dem Glauben in Konflikt, der bedeutet, etwas für gewiß zu halten. Treten sie aber mit Bestimmtheit auf, setzen ich sich in Widerspruch zu ihren Gegenstand, der notwendig unbestimmt ist. Wahrscheinlich ist dies der Grund dafür, dass manche Theologen Definitionen und Ableitungszusammenhänge lieben. Sie können vergessen machen, auf welch‘ schwankendem Grund man sich befindet.
19.4.2001
Wer wissen will, welchen Wert die Frau im Koran hat, findet dazu einiges in der einschlägigen vierten Sure, die mit „Die Weiber“ überschrieben ist. Diese enthält große Teile des nicht eben frauenfreundlichen islamischen Familien- und Erbrechts, darunter die Regelung, dass sich der Mann bis zu vier Frauen nehmen dürfe (besser, so heißt es dort, sei es allerdings, wenn er nur eine Frau nehme und zur Befriedigung überschießender Bedürfnisse Sklavinnen kaufe, die offenbar nicht unter den Begriff Frau fallen). Aufschlussreiches zum Thema Frauen steht aber auch in der zweiten und dritten Sure. In Vers 224 der zweiten Sure heißt es: „Die Weiber sind euer Acker. Geht auf euren Acker, wie und wann ihr wollt.“ Die Bearbeitung des Ackers scheint aber allein Männersache zu sein. Über entsprechende ländliche Vergnügungsmöglichkeiten der Frauen wird nichts gesagt (auch nichts darüber, wieweit ihr Wille bei den agrikulturellen Aktivitäten des Mannes eine Rolle spielt). Das Thema scheint ausschließlich die Männer zu betreffen, weswegen sich der Text auch nur an diese richtet. In der dritten Sure, Vers 15, ist davon die Rede, dass dem Menschen die begehrliche Lust an Frauen, Kindern, Gold und Silber, edlen Pferden, Viehherden und viel Ackerland eingepflanzt sei. Die Frauen, die hier in bezeichnender Nachbarschaft erscheinen, fallen dabei offenbar nicht unter den Begriff Mensch. Denn dass es Menschen gibt, die begehrliche Lust an einem Mann habe könnten, ist nicht erwähnt. In Vers 16 der gleichen Sure heißt es, die Frommen würden von Allah einst Gärten, die von Flüssen durchströmt werden, erhalten, in denen sie ewig verweilen. Dort würden ihnen, neben dem Wohlgefallen Allahs, unbefleckte Frauen zuteil werden (in einer anderen Sure wird dies dahingehend spezifiziert, dass die Jungfrauen immer wieder aufs Neue unbefleckt würden). Das wirft zunächst einmal die Frage auf, was befleckte Frauen sind und was mit diesen geschieht. Davon abgesehen fällt auf, dass Frauen offenbar auch nicht unter den Begriff „Fromme“ fallen. Jedenfalls wird nichts darüber gesagt, dass und wie sie im Paradies belohnt werden, insbesondere, ob ihnen dort ein unbefleckter Mann oder gar mehrere zuteil werden (wenn denn bei Männern eine Unterscheidung zwischen befleckt und unbefleckt überhaupt gemacht wird). Den genauen Wert der Frau erfährt man schließlich in Vers 283 der zweiten Sure. Dort heißt es, die Schuldverpflichtung einer Person, welche die Auswirkung derselben möglicherweise nicht überblicke, müsse schriftlich und in Gegenwart von zwei Zeugen abgemacht werden. Habe man dafür keine zwei Männer, könne man auch einen Mann und zwei Frauen nehmen, woraus sich der Wert einer Frau mit arithmetischer Genauigkeit ermitteln lässt
12.5.2001
Wie sich die Zeiten ändern. Von den sieben Hauptsünden des Islam (Götzendienst, falsches Zeugnis, Betrug an Waisen, Flucht im Religionskrieg, Ungehorsam gegen Eltern, Wucher und Mord) wird in den modernen Gesellschaften nur noch letzterer für wirklich gravierend gehalten. Dafür halten diese Sexualdelikte, Raub und Anzettelung eines Krieges für kapital.
21.9.2001
Bei der Frage, ob der Islam in besonderem Maße zur Gewalttätigkeit neigt, sollte man eigentlich zwischen den Muslimen und dem Koran unterscheiden. Für die Muslime stellt sich die Frage möglicherweise ähnlich oft oder selten, wie für die Anhänger anderer großer Religionen. Sprache und Inhalt des Koran offenbaren hingegen ein ziemlich archaisches Verhältnis zur Gewalt. Das Problem ist allerdings, dass sich Muslime wesentlich schwerer von Koran trennen lassen, als etwa Christen von der Bibel.
25.9.2001
Die feinen Unterschiede zwischen Islam und Christentum: Die Christen sagen, Gottes Ratschluss sei unerforschlich, im Koran heißt es schlicht, Allah macht, was er will.
29.11.2001
Die Annahme der islamischen Krieger, sie gingen, wenn sie bei Verteidigung des Glaubens sterben, sofort in das Paradies ein, ist nicht ohne Risiko. Was ist wenn Allah, der ja, um die illegale Einwanderung in das Paradies zu verhindern, die Motivation der Krieger überprüfen muss, zu dem Ergebnis kommt, dass sie (oder ihre Kriegsherren) bei der Feststellung, dass der Glauben angegriffen worden sei, allzu großzügig waren?
4.4.2002
Die Verachtung der Sexualität führt mit Notwendigkeit zur Diskriminierung der Frau (vgl. Paulus); die Überbetonung derselben ebenso (siehe den Islam).
25.10.2002
Dass der Islam so viele Probleme damit hat, Staat und Kirche zu trennen, liegt daran, dass sein Gründer ein Politiker war.
16.9.2010
Den Islam wird man dann als aufgeklärt bezeichnen können, wenn man im Koran die Formulierung für Menschen, die einer anderen Religion angehören, nicht mehr mit „Ungläubige“, sondern mit „Andersgläubige“ übersetzt. Der Schritt ist nicht klein. Übersetzungen sind auch Interpretationen und diese verfügen über den Text, was bei Gottes Text nicht so einfach ist.
2.3.2011
Das Christentum war einmal ähnlich intolerant und gewalttätig wie es der Islam heute teilweise ist. Da die Gründe dafür ebenfalls ähnlich waren, kann man für den Islam noch hoffen.
2019
Dass von Christen nichts wirklich Kritisches über den Islam kommen kann, hat seinen Grund darin, dass man das Glashaus nicht zerschmettern will, in dem man gemeinsam sitzt.
27.8.1998
Der logische Weg zur Beseitigung der Privilegien des muslimischen Mannes ist, dass die Frauen die Männer aktiv anmachen. Denn da die Pflicht zur Verdeckung der Reize der Frau damit begründet wird, dass damit die Aufreizung der Männer verhindert werde, müsste Gleichberechtigung dadurch erreicht werden können, dass sich die Frauen von der mangelnden Bedeckung des Mannes gereizt zeigen.
8.2.1999
Die Autoren einiger wichtiger religiöser Grundbücher, alles Männer, hatten offensichtlich erhebliche Schwierigkeiten mit dem weiblichen Geschlecht. Dieser Schluss drängt sich angesichts der Tatsache auf, dass sie es für nötig hielten, die Frau massiv in die Schranken zu weisen. Eigentlich sind ihre Aussagen so klar, dass sie keines Kommentars bedürfen. Da wir sie heute – vermutlich weil sie zu klar sind – meist aber nur in kommentierter, das heißt in stark abgeschwächter Form zu hören bekommen, hier zunächst einmal der originale Wortlaut:
In der Bibel (Mose Buch 1, Kapitel 3, Vers 16) heißt es, Gott habe zu Eva nach dem Sündenfall in einer Art Strafpredigt gesagt: „Ich will Dir viel Mühsal schaffen, wenn Du schwanger bist, unter Mühe sollst Du Kinder gebären. Und Dein Verlangen soll nach Deinem Mann sein, aber er soll Dein Herr sein.“
In der 4. Sure des Korans (Vers 35) findet sich die folgende Passage: „Männer sollen vor Frauen bevorzugt werden…Rechtschaffene Frauen sollen gehorsam, treu und verschwiegen sein. … Diejenigen Frauen, von denen ihr fürchtet, dass sie euch durch ihr Betragen erzürnen, gebt Verweise, enthaltet euch ihrer, sperrt sie in ihre Gemächer und züchtigt sie.“
Nicht weniger eindeutig ist das Gesetzbuch des Manu, das altehrwürdige Sittenbuch der Hindus, das vor rund 2000 Jahren auf der Basis älterer Werke entstand. Dort heißt es über die Frauen (Vers 147ff):“ Ein Mädchen, eine junge oder auch eine ältere Frau, darf nichts unabhängig tun, nicht einmal in ihrem eigenen Haus. In der Kindheit muss eine Frau ihren Vater unterworfen sein, in der Jugend ihrem Mann, und wenn ihr Herr tot ist, ihren Söhnen. Eine Frau darf nie unabhängig sein. Sie muss immer freundlich sein, klug bei der Führung des Haushaltes und sparsam bei den Ausgaben. Sie muss gegen den, dem sie der Vater oder – mit dessen Erlaubnis – der Bruder gibt, so lange folgsam sein, als er lebt und wenn er tot ist, darf sie sein Andenken nicht verunglimpfen.“
Ähnliche Gedanken finden sich bei Konfutius, der den Gehorsam der Frau gegenüber dem Mann für eine der Grundlagen einer funktionierenden Gesellschaft hält.
Nach dem Grundsatz, dass man mehr aus dem erkennen kann, was der Mensch bestreitet, als aus dem, was er behauptet, zeigen derart entschiedene Regelungen, dass der Mann mit dem Verhältnis der Geschlechter außerordentlich unzufrieden war. Dies gilt um so mehr, als die Vorwürfe, die dahinter liegen, kaum verborgen sind. Wie groß der Mann sein Elend empfand, kann man etwa daraus schließen, dass er sich im Verhältnis zur Frau nicht etwa mit der Rolle des Gesetzgebers begnügte, sondern gleich auch noch Exekutive und die Judikative beanspruchte. Dass eine Frau gegenüber einem pflichtvergessenen Mann vergleichbare Befugnisse haben könnte, wird nicht einmal als Möglichkeit in Erwägung gezogen. Während Manu und der Koran sich darauf beschränken, die Unterwerfung der Frau unter den Mann festzustellen, tun die Autoren der Bibel ein weiteres. Sie belegen die Frau mit einer Schuld, die im Grunde nicht zu verzeihen ist. Ihr wird die Verantwortung dafür angelastet, dass der Mensch – und das ist nicht zuletzt der Mann – aus dem Paradies getrieben wurde.
Fragt man sich, was für die Männer so unbefriedigend war, dass sie sich zu derart drastischen Regelungen genötigt sahen, so geben die Verhältnisse zwischen den Geschlechtern in der Führungsebene des Neuen Testamentes Hinweise. Bekanntlich wird im neuen Testament die Frau aus der himmlischen Familie eliminiert. Dies machte nicht nur ziemlich komplizierte Erläuterungen zur Funktionsweise des göttlichen Fortpflanzungsprozesses erforderlich, sondern führte auch zu recht merkwürdigen Familienverhältnissen. Denn die göttliche Familie, zu der Maria mangels Gottheit nicht gezählt werden kann, besteht nur aus Männern. Da zu einer Familie aber auch im Himmel mindestens drei Personen gehören, hat der Sohn Gottes – eine Tochter kam offenbar erst gar nicht in Frage – zwei Väter, einen, der ihn erzeugte, nämlich den heiligen Geist, und einen, der die elterliche Gewalt besitzt, Gott Vater. Da zwei Väter nun aber in der Natur nicht vorkommen, spricht alles dafür, dass in der Trinität einer der beiden Männer die soziale Rolle der Mutter übernahm. Dies kann, da der heilige Geist als Erzeuger feststeht, nur Gott Vater sein.
Die Macht Gott Vaters in dieser Familie wird als außerordentlich dargestellt, so groß, dass er von seinem Kind sogar den Tod verlangen kann. Wenn Gott Vater daher die Rolle der Mutter übernommen hat, so liegt der Rückschluss nahe, dass auch die Machtstellung der Mutter ursprünglich einmal sehr groß war. Damit hätten wir einen guten Grund dafür, dass die Männer die Dinge so entschieden in die eigenen Hände genommen haben. Es ist leicht nachzuvollziehen, dass der Mann eine übermäßige Macht der Frau als unbefriedigend empfand. Wenn diese Macht so groß gewesen sein sollte wie die, welche Gott Vater besaß, dürfte sie der Mann nicht zu Unrecht auch als bedrohlich empfunden haben. Alles spricht daher dafür, dass der Zustand, der dem Mann so unerträglich erschien, so etwas wie ein faktisches Matriarchat war, mit anderen Worten die vitale und soziale Überlegenheit der Frau gegenüber dem Mann, die sich unter anderem in ihrer deutlich höheren Lebenserwartung spiegelt.
Über die tatsächliche Basis dieser Macht braucht man kaum zu spekulieren. Sie dürfte neben dem Einfluss, den eine Mutter auf den Nachwuchs hat, nicht zuletzt darin begründet gewesen sein, dass die Nachfrage von Mann nach Frau tendenziell das Angebot der letzteren übersteigt, was nach Adam Smith zu einem fallenden Preis für Mann führt. Es liegt auf der Hand, dass sich die Männer dagegen mit dem (Macht)Monopol zu retten versuchten, das sich in den anfangs zitierten Texten findet.
Darauf dass hinter allem ein Marktproblem steckt, deuten im übrigen verklausulierte Formulierungen in den heiligen Büchern. Im Koran wird das (Nachfrage-)Problem durch seine Umkehr ausgedrückt. Dort werden die Männer aufgefordert, sich der (unbotmäßigen) Weiber zu enthalten, was die Tatsachen in bezeichnender Weise auf den Kopf stellt. Die Bibel bringt mit dem Satz „Und Dein Verlangen soll nach deinem Mann sein“ ganz auf dem Punkt, worum es geht: die Umkehr der „natürlichen“ Nachfrageverhältnisse.
19.4.2001
Wer wissen will, welchen Wert die Frau im Koran hat, findet dazu einiges in der einschlägigen vierten Sure, die mit „Die Weiber“ überschrieben ist. Diese enthält große Teile des nicht eben frauenfreundlichen islamischen Familien- und Erbrechts, darunter die Regelung, dass sich der Mann bis zu vier Frauen nehmen dürfe (besser, so heißt es dort, sei es allerdings, wenn er nur eine Frau nehme und zur Befriedigung überschießender Bedürfnisse Sklavinnen kaufe, die offenbar nicht unter den Begriff Frau fallen). Aufschlussreiches zum Thema Frauen steht aber auch in der zweiten und dritten Sure. In Vers 224 der zweiten Sure heißt es: „Die Weiber sind euer Acker. Geht auf euren Acker, wie und wann ihr wollt.“ Die Bearbeitung des Ackers scheint aber allein Männersache zu sein. Über entsprechende ländliche Vergnügungsmöglichkeiten der Frauen wird nichts gesagt (auch nichts darüber, wieweit ihr Wille bei den agrikulturellen Aktivitäten des Mannes eine Rolle spielt). Das Thema scheint ausschließlich die Männer zu betreffen, weswegen sich der Text auch nur an diese richtet. In der dritten Sure, Vers 15, ist davon die Rede, dass dem Menschen die begehrliche Lust an Frauen, Kindern, Gold und Silber, edlen Pferden, Viehherden und viel Ackerland eingepflanzt sei. Die Frauen, die hier in bezeichnender Nachbarschaft erscheinen, fallen dabei offenbar nicht unter den Begriff Mensch. Denn dass es Menschen gibt, die begehrliche Lust an einem Mann habe könnten, ist nicht erwähnt. In Vers 16 der gleichen Sure heißt es, die Frommen würden von Allah einst Gärten, die von Flüssen durchströmt werden, erhalten, in denen sie ewig verweilen. Dort würden ihnen, neben dem Wohlgefallen Allahs, unbefleckte Frauen zuteil werden (in einer anderen Sure wird dies dahingehend spezifiziert, dass die Jungfrauen immer wieder aufs Neue unbefleckt würden). Das wirft zunächst einmal die Frage auf, was befleckte Frauen sind und was mit diesen geschieht. Davon abgesehen fällt auf, dass Frauen offenbar auch nicht unter den Begriff „Fromme“ fallen. Jedenfalls wird nichts darüber gesagt, dass und wie sie im Paradies belohnt werden, insbesondere, ob ihnen dort ein unbefleckter Mann oder gar mehrere zuteil werden (wenn denn bei Männern eine Unterscheidung zwischen befleckt und unbefleckt überhaupt gemacht wird). Den genauen Wert der Frau erfährt man schließlich in Vers 283 der zweiten Sure. Dort heißt es, die Schuldverpflichtung einer Person, welche die Auswirkung derselben möglicherweise nicht überblicke, müsse schriftlich und in Gegenwart von zwei Zeugen abgemacht werden. Habe man dafür keine zwei Männer, könne man auch einen Mann und zwei Frauen nehmen, woraus sich der Wert einer Frau mit arithmetischer Genauigkeit ermitteln lässt.
5.9.2001
In der Diskussion um Toleranz einigt man sich gerne auf die Formulierung, jeder müsse zu dem Eingeständnis bereit sein, dass seine Wahrheit nur relativ sei. Klingt gut und ist sicher auch gut gemeint. Hat aber zur Folge, dass in Falle des Verhältnisses von Islam und westlicher Kultur die Gleichberechtigung der Frau zur relativen Wahrheit wird.
27.9.2001
Religiöse Logik: Wie andere Glaubensbringer sah sich auch Mohammed immer wieder dazu veranlasst, der Vorstellung entgegenzutreten, dass seine Reden Behauptungen eines Poeten, Wahrsagers oder gar Betrügers seien. Um seine Anhänger davon zu überzeugen, dass es sich nicht darum, sondern um „Offenbarungen des Herrn der Welten“ und die Sprache eines „ehrwürdigen Gesandten“ handele, legt er in der 69 Sure (Vers 39 ff) zunächst einen Schwur ab, und zwar bei dem, was man sieht und was man nicht sieht (nach einer anderen Interpretation soll er allerdings das Schwören mit der Begründung ablehnen, der Sachverhalt sei so sicher, dass er nicht schwören brauche – was in der Sache so ziemlich auf das gleiche hinausläuft). Dann lässt er Allah unmittelbar mit dem Satz zu Wort kommen: „Hätte er (Mohammed) einen Teil dieser Verse als von uns gesprochen ersonnen, so hätten wir ihn an der rechten Hand ergriffen und ihm die Herzadern durchschnitten, auch hätten wir keinen von Euch abgehalten, ihn zu züchtigen“. Damit wird der Beweis zum einen mit einem Schwur bei allem und nichts geführt, zum anderen mit der Aussage eines Zeugen, der (nur) durch den Mund eben dessen sprechen kann, der ihn zum Beweis anführt, und schließlich mit dem Nichteintritt von Ereignissen, von denen der Beweisführende weiß, dass sie nicht eingetreten sind bzw. bei denen er davon ausgehen kann, dass sie nicht eintreten werden.
14.12.2010
Koinzidenz oder systemimmanent? Jede Menge der Texte, welche die denkbar größte Authentizität beanspruchen und höchstes Ansehen genießen, sind in wichtigen Punkten gefälscht. Sie stammen insbesondere oft nicht oder nicht so von den Autoren, von denen sie ihr Gewicht ableiten. Dies gilt etwa für den Koran, der in der Form, in der er schriftlich überliefert ist, nicht etwa von Mohammed und schon gar nicht aus direkt aus dem Himmel stammt, sondern nach seinem Tod zusammengestellt wurde (über das Beglaubigungsverfahren, das dabei Jahre wenn nicht Jahrzehnte nach Mohammeds Tod angewendet worden sein soll, heißt es einigermaßen naiv, mindestens jeweils zwei Personen hätten bestätigen müssen, dass sie den jeweiligen Vers selbst aus den Munde des Propheten gehört hatten). Bei der Bibel geht man davon aus, dass etwa das Buch Jeseja aus den Texten verschiedener Autoren stammt. Die vier Evangelien des Neuen Testamentes stammen nach allen Erkenntnissen nicht von den Christus nahe stehenden Personen, denen sie zugeschrieben werden, sondern sind offenbar später von Personen verfasst wurden, die Jesus nicht mehr selbst erlebt haben, was natürlich wesentliche Auswirkungen auf ihre Glaubhaftigkeit hat. Die Chinesen haben ihre klassischen Schriften so oft überarbeitet, ergänzt oder gänzlich neu geschrieben, dass man, wie etwa bei Konfutius, nicht mehr weiß, was wirklich von den Autoren stammt, denen sie zugeschrieben werden. Auch bei den Schriften Homers, einem der Grundwerke der Antike und überhaupt der europäischen Kultur, vermutet man mehrere Autoren.
Koinzidenz oder systemimmanent? Wahrscheinlich eher Letzteres. Dabei wird man allerdings nie ganz auseinander dividieren können, ob die Fälschungen dazu dienten, die erhöhte Glaubhaftigkeit zu erzeugen oder ob sie die Folge der bereits bestehenden Autorität waren, die man nutzen wollte.
23.2.2010
Es kann dahingestellt bleiben, ob es in den westlichen Gesellschaften zu einem Kampf der Kulturen kommen wird. Tatsache ist jedenfalls, dass hier zunehmend Menschen von Kulturen aufeinander stoßen, die ein gänzlich unterschiedliches Weltbild haben. Die christliche Religion hat sich, wenn auch zögerlich, dem wissenschaftlichen Weltbild weitgehend angepasst und ist schließlich zu einem neuen (abstrakteren) Verständnis ihrer Textgrundlagen gekommen. Dieses steht nicht mehr in einem übermäßig krassen Widerspruch zu den sonstigen Erfahrungen der Menschen. Der Islam hingegen ist im Wesentlichen bei einem unkritischen Textverständnis geblieben und bietet seinen Gläubigen in vielen Einzelheiten ein Weltbild an, welches im eklatanten Widerspruch zu den Alltagserfahrungen steht. Er hat zum Beispiel größte Probleme, sich mit der Frage der Entstehung des Korans auseinanderzusetzen und ist bei der Vorstellung stehen geblieben, dass sein heiliges Buch im Himmel in arabischer Sprache auf Marmorplatten aufgeschrieben und vom Erzengel Gabriel zu Mohammed gebracht worden sei. Dass dieses Textverständnisses geändert werden könnte, ist von innen heraus so bald nicht zu erwarten. Ein genereller Grund ist, dass die Maßstäbe für die Entwicklung solcher Änderungen in Gesellschaften formuliert werden, welche im Ganzen so strukturiert sind, dass der Widerspruch zu Alltagsrealität weniger deutlich wird als in den sekularisierten westlichen Gesellschaften, in denen wissenschaftliches Denken weit verbreitet ist. Damit fehlt ein wichtiger gesellschaftlicher Impuls zur Veränderung. Vor allem aber herrscht bei den Religionsführern der islamischen Gesellschaften eine fundamentale Angst davor, dass mit einer historisch-kritischen Herangehensweise an die heiligen Texte eine Schleuse geöffnet wird, durch die nicht mehr kontrollierbare Kritik strömen wird. Dabei steht ihnen ohne Zweifel der massive Ansehens- und Bedeutungsverlust vor Augen, den die heiligen Texte der Christen und mit ihnen ihre Interpreten erlitten haben, nachdem man begonnen hat, sich den Texten historisch-kritisch zu nähern. Es scheint, dass die islamischen Theologen daher selbst offenkundige Ungereimtheiten für das wesentlich kleinere Übel halten.
Es liegt auf der Hand, dass sich fortgeschrittene Gesellschaften nur eine begrenzte Anzahl von Menschen leisten können, die ein derart rückständiges Weltbild besitzen. Sie müssen daher dafür sorgen, dass das Weltbild der Muslime dem ihren angenähert wird. Da von islamischer Seite aus den genannten Gründen wenig Initiative zu erwarten ist, müssen die fortgeschrittenen Gesellschaften die Initiative selbst ergreifen. Es bleibt daher kaum etwas anderes übrig, als dass die westlichen Gesellschaften den historisch-kritischen Umgang mit den relevanten Texten selbst in die Hand nehmen.
